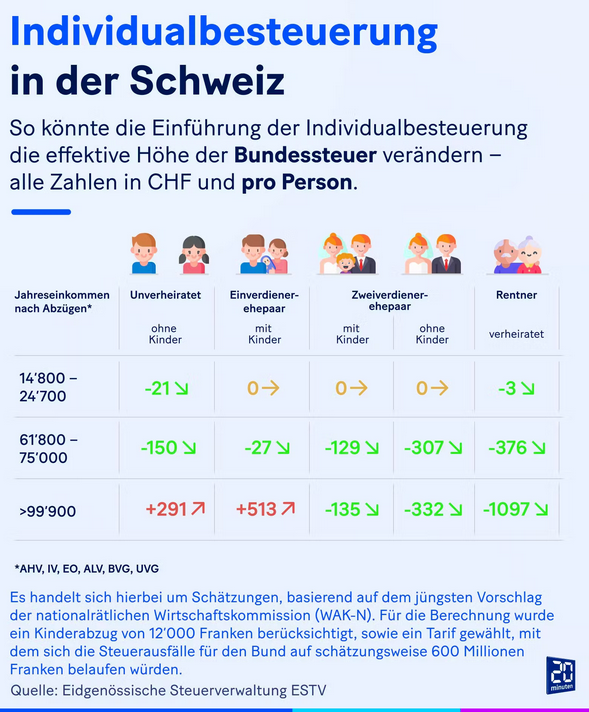Deutlicher Anstieg der Erwerbsbeteiligung der 55- bis 64-Jährigen
Zwischen 2014 und 2024 stieg das durchschnittliche Alter der Erwerbsbevölkerung von 41,2 auf 42,3 Jahre. Im selben Zeitraum erhöhte sich die Erwerbsquote der 55- bis 64-Jährigen um 6,1 Prozentpunkte auf 77,8%. 2024 traten die Erwerbspersonen im Schnitt mit 65,3 Jahren (Männer) bzw. mit 64,7 Jahren (Frauen) aus dem Arbeitsmarkt aus. Das Verhältnis zwischen Personen im ordentlichen Rentenalter und den Erwerbspersonen ist innerhalb der letzten zehn Jahre kontinuierlich gestiegen (2014: 33,7; 2024: 37,4). Dies geht aus der Schweizerischen Arbeitskräfteerhebung (SAKE) des Bundesamtes für Statistik (BFS) hervor.
Im Jahr 2024 war die Erwerbsbevölkerung durchschnittlich 42,3 Jahre alt (2014: 41,2 Jahre). Schweizerische Erwerbspersonen (43,1) sind knapp drei Jahre älter als ausländische Erwerbspersonen (40,4); zwischen Männern und Frauen beläuft sich die Differenz auf 0,4 Jahre (Männer: 42,5; Frauen: 42,1). In den Wirtschaftsbranchen ist die Altersstruktur sehr unterschiedlich. Das höchste Durchschnittsalter der Erwerbspersonen ist in der Land- und Forstwirtschaft zu verzeichnen (47,9), das Tiefste im Gastgewerbe (40,6). Zwischen Arbeitnehmenden (42,4) und Selbstständigerwerbenden (49,2) beläuft sich die durchschnittliche Altersdifferenz auf knapp sieben Jahre.
Starke Zunahme der Erwerbsquote der 55- bis 64-Jährigen
Zwischen 2014 und 2024 stieg die Erwerbsquote der 55- bis 64-Jährigen von 71,6% auf 77,8%. Bei den Frauen fiel die Zunahme stärker aus als bei den Männern (+7,8 Prozentpunkte auf 71,9% gegenüber +4,5 Prozentpunkte auf 83,6%). Auch in Vollzeitäquivalenten (VZÄ) ausgedrückt hat sich die Erwerbsbeteiligung dieser Altersgruppe deutlich erhöht (+5,1 Prozentpunkte auf 65,3%). Die Erwerbsquote in VZÄ ist bei den Frauen (51,7%) aufgrund der weit verbreiteten Teilzeiterwerbstätigkeit wesentlich tiefer als bei den Männern (78,9%), im Zehnjahresvergleich war die Zunahme bei Ersteren aber mehr als doppelt so hoch (+7,1 Prozentpunkte gegenüber +3,0 Prozentpunkte).
23,0% der 65- bis 74-jährigen Männer beteiligen sich am Arbeitsmarkt
Von den 65- bis 74-Jährigen waren im Jahr 2024 18,8% auf dem Arbeitsmarkt aktiv, was gegenüber 2014 einem Anstieg von 1,4 Prozentpunkten entspricht. Bei Männern dieser Altersgruppe beläuft sich die Erwerbsquote auf 23,0% (+0,7 Prozentpunkte), bei Frauen auf 15,2% (+1,9 Prozentpunkte). Die ausgesprochen hohen Teilzeitquoten in dieser Altersgruppe (Total: 85,3%; Männer: 79,8%; Frauen: 92,5%) widerspiegeln sich in den Erwerbsquoten in VZÄ. So beläuft sich die entsprechende Quote der 65- bis 74-Jährigen noch auf 7,9% (Männer: 11,3%; Frauen: 4,9%).
55- bis 64-Jährige weniger von Erwerbslosigkeit gemäss ILO betroffen
Personen im Alter von 55 bis 64 Jahren sind seltener erwerbslos als die Gesamtbevölkerung von 15 bis 74 Jahren. 2024 lag die Erwerbslosenquote gemäss Definition des Internationalen Arbeitsamtes (ILO) bei den 55- bis 64-Jährigen bei 3,4%, während sie sich bei den 15- bis 74-Jährigen auf 4,3% belief. 55- bis 64-jährige Frauen weisen gar eine tiefere Erwerbslosenquote gemäss ILO auf als gleichaltrige Männer (3,1% gegenüber 3,8%; Gesamtbevölkerung: 4,6% gegenüber 4,1%).
Erwerbspersonen treten im Schnitt mit 65,0 Jahren aus dem Arbeitsmarkt aus
Das durchschnittliche Alter beim Austritt aus dem Arbeitsmarkt lag 2024 bei 65,0 Jahren (Männer: 65,3 Jahre; Frauen: 64,7 Jahre). Zehn Jahre zuvor belief es sich bei den Erwerbspersonen auf demselben Niveau, innerhalb der untersuchten Zeitspanne war das durchschnittliche Alter beim Austritt aus dem Arbeitsmarkt aber gewissen Schwankungen unterworfen. Der höchste Wert entsprach 2017 65,8 Jahren. Nach der Covid-19 Pandemie sank das Durchschnittsalter insbesondere in den Jahren 2022 und 2023 (64,7 bzw. 64,5). Werden nur Arbeitnehmende berücksichtigt, fällt das geschätzte Austrittsalter tiefer aus als für die Erwerbspersonen insgesamt (64,5 Jahre).
Verhältnis zwischen Personen im Rentenalter und Erwerbspersonen gestiegen
Im Jahr 2024 entfielen auf 100 Erwerbspersonen im Alter von 20 bis 64 Jahren 37,4 Personen ab 65 Jahren. Innerhalb der letzten Jahre nahm dieser Quotient aufgrund der demografischen Alterung kontinuierlich zu (2014: 33,7).
Weiterlesen