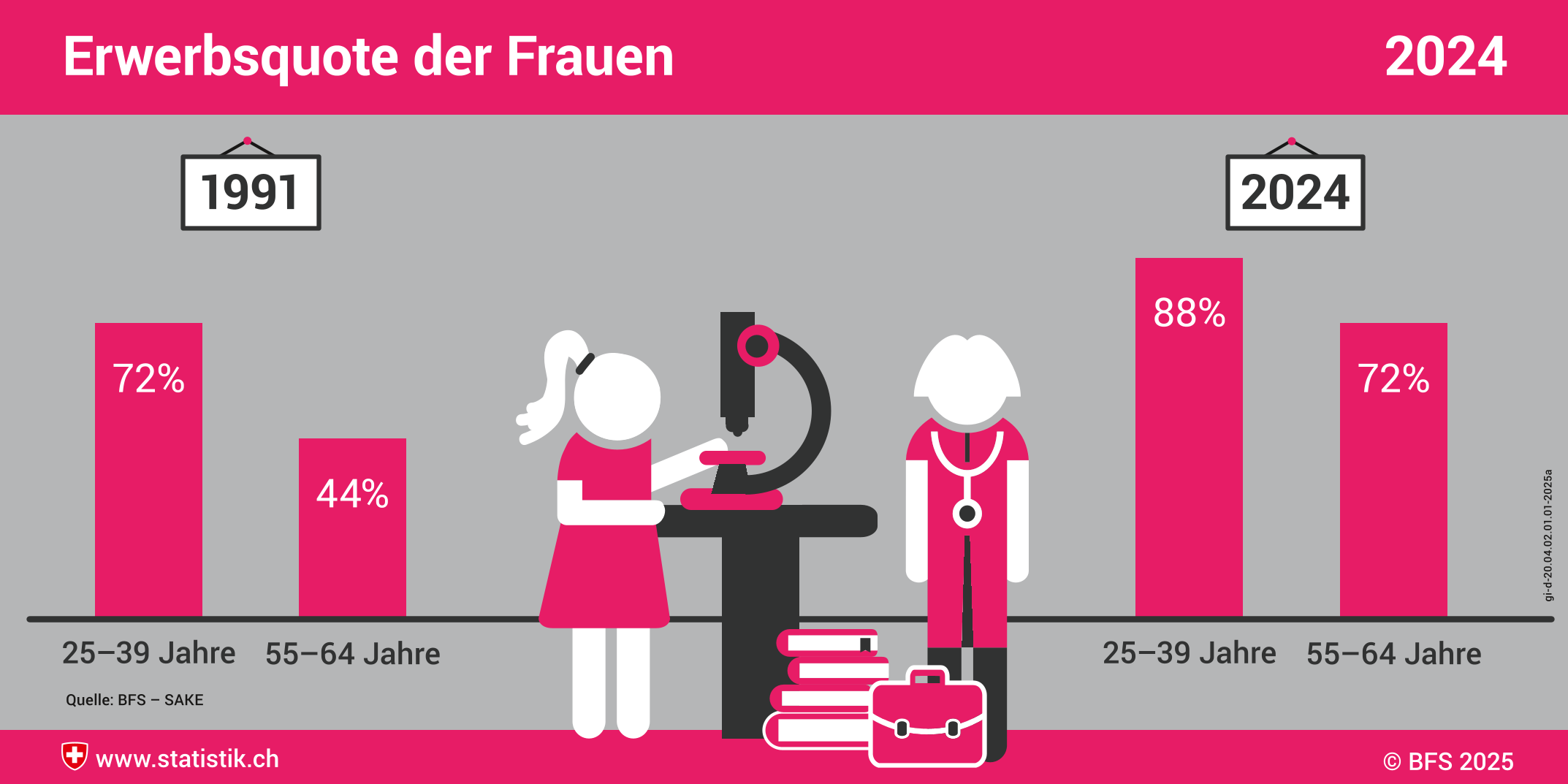Sechs Kinder, das jüngste gerade vier Monate alt: Manouilah Ugokwe lebt für ihre Familie. Auch wenn das Geld oft knapp ist, würde sie ihr Glück um nichts in der Welt eintauschen. Eigentlich ist alles schön, weil die Freude, die sie mir bringen, unbezahlbar ist», sagt die 35-Jährige. Sie ist stolz darauf, dass in ihrer Familie offen geredet wird. Doch so sehr sie das Familienleben liebt – der Alltag mit vielen Kindern ist nicht immer einfach.
Als sie mit ihrem jüngsten Sohn Chibueze schwanger war, bereitete ihr die finanzielle Situation Sorgen. Wie sollte sie all die Dinge finanzieren, die ein Neugeborenes braucht? Hilfe fand sie beim Solidaritätsfonds für Mutter und Kind des Katholischen Frauenbundes. Die Organisation unterstützte sie unbürokratisch, sodass sie sich ein Bett und einen Kinderwagen leisten konnte. «Das hat mir eine grosse Last genommen», sagt sie.
Ein sicherer Start ins Leben
Jedes Jahr unterstützt der Solidaritätsfonds hunderte Frauen in der Schweiz, die in eine finanzielle Notlage geraten sind. Besonders betroffen sind Alleinerziehende, Working-Poor-Familien oder Eltern mit mehreren Kindern. Gerade in Zeiten steigender Lebenshaltungskosten ist die Nachfrage hoch: 2023 wurden 428 Gesuche bewilligt. Der Fonds hilft dort, wo das soziale Netz Lücken aufweist. Die finanzielle Unterstützung kann für Baby-Grundausstattungen, Kinderbetreuung, Mietrückstände oder gar medizinische Kosten genutzt werden. Die Hilfe steht Frauen unabhängig von ihrer Religion, ihrem Zivilstand oder Aufenthaltsstatus offen. Wichtig ist allein die akute Notsituation.
Mehr als Geld: Beratung und Perspektiven
Doch es geht nicht nur um ökonomische Hilfe. «Wir wollen Familien nicht nur über Wasser halten, sondern sie stärken, sodass sie eigene Ziele verfolgen können», sagt Monika Grass vom Katholischen Frauenbund Basel-Stadt. Seit neun Jahren begleitet Monika Grass Manouilah Ugokwe bei Erziehungs- und Berufsfragen. Ihr langfristiges Ziel: die Wiederaufnahme ihrer Ausbildung zur Fachfrau Gesundheit.
Hilfe, die ankommt – und bleibt
Seit fast 50 Jahren leistet der Solidaritätsfonds rasche Hilfe, wenn Mütter in der Schweiz unverschuldet in eine Notlage geraten. Doch die steigende Nachfrage setzt den Fonds unter Druck. Während die Ausgaben 2023 knapp 900'000 Franken betrugen, resultierte ein Defizit von rund 60'000 Franken. Die Organisation ist daher weiterhin auf Spenden angewiesen. Für Manouilah Ugokwe war die Hilfe des Fonds ein Segen. «Ich liebe meine Familie», sagt sie. «Und dank der Unterstützung kann ich sie mit mehr Sicherheit und Zuversicht begleiten.»