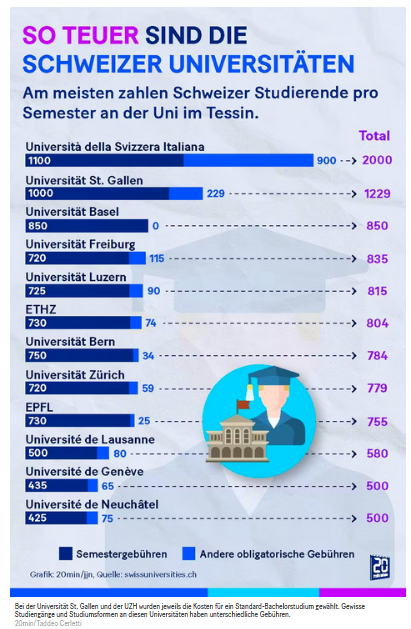Hat die AHV viele Mütter benachteiligt? Ein brisantes Gerichtsurteil sagt Ja
Eigentlich soll sie die Gleichberechtigung fördern. Doch offenbar wird die Erziehungsgutschrift falsch abgerechnet. Es geht um Tausende von Franken.
Für Ruth Dreifuss war es ein persönlicher Triumph: Im Jahr 1995 erreichte die SP-Magistratin beim Volk ein deutliches Ja für die 10. AHV-Revision – bis heute ist dies die letzte grosse Reform der Altersvorsorge. Eine zentrale Neuerung bildete dabei die Einführung der Erziehungsgutschrift.
Schon als Gewerkschafterin, bevor sie in den Bundesrat kam, kämpfte Dreifuss für die Gleichberechtigung der Frauen in der AHV: «Die Erziehungsgutschrift dient als Anerkennung für die unbezahlte Arbeit: in Form eines fiktiven Lohns, um die Renten von Frauen aufzubessern», erklärte sie ihre Forderung.
30 Jahre später jedoch sieht sich die AHV plötzlich einem brisanten Vorwurf ausgesetzt: Ist das Sozialwerk gar nicht so frauenfreundlich, wie es damals versprochen wurde? Das Neuenburger Kantonsgericht hält in einem neuen Urteil nämlich fest, die geltende Regelung bei den Erziehungsgutschriften bedeute für Mütter eine Benachteiligung.
Worum geht es? Hinter dem Fall steht der 62-jährige FDP-Politiker Philippe Gnaegi, der unter anderem dem Neuenburger Staatsrat angehörte. Zurzeit ist er Direktor der Organisation Pro Familia. Zudem arbeitet er als Lehrbeauftragter an der Universität Freiburg und hat ein Standardwerk zur Geschichte der Sozialversicherungen publiziert.
Benachteiligung der Ehefrau
Gnaegi hat im Fall seiner eigenen Ehefrau Beschwerde gegen die AHV-Ausgleichskasse eingereicht. Seine Gattin ist älter als er und hat daher bereits das Pensionsalter erreicht. Das heisst für die Berechnung ihrer Rente: Solange nur sie AHV-berechtigt ist und der Mann noch arbeitet, richtet sich die Rentenhöhe nach ihrem eigenen lebenslangen Einkommen bis zur Pensionierung. Erst wenn der Ehepartner ebenfalls den Ruhestand erreicht, werden die beiden Einkommen hälftig geteilt.
Allerdings behandelt die AHV-Ausgleichskasse das Erwerbseinkommen und die Erziehungsgutschrift unterschiedlich: Während Ersteres zu 100 Prozent angerechnet wird, fliesst die Erziehungsgutschrift nur zur Hälfte in die AHV-Berechnung ein. Diese Praxis kam auch bei Gnaegis Ehefrau zur Anwendung. «Im Fall meiner Frau erachte ich diese Regelung als diskriminierend», erklärt Philippe Gnaegi. «Denn während ich als Vater zu 100 Prozent erwerbstätig blieb, hat allein meine Frau ihr Pensum reduziert, um unsere drei Kinder besser betreuen zu können.»
Die heutige Praxis, die Erziehungsgutschrift zu splitten, widerspreche dem ursprünglichen Gleichstellungsgedanken bei der Einführung der AHV-Reform, betont der Direktor von Pro Familia. «Wenn einzig die Frau wegen der Kinder eine Einkommenseinbusse erleidet, so muss sie konsequenterweise auch die gesamte Kompensation erhalten.»
Tausende Mütter sind betroffen
Er habe diesen Musterprozess nicht primär wegen seiner Frau angestrengt, sondern um die Altersvorsorge von Tausenden Müttern zu verbessern, sagt Gnaegi. Er verweist auf die AHV-Statistik zur Rentenhöhe bei Verheirateten, bei denen erst ein Partner rentenberechtigt ist: Während Männer eine monatliche Rente von 2047 Franken erreichen, kommen Frauen im Schnitt auf lediglich 1574 Franken.
Das Problem betreffe nicht nur Frauen, so Gnaegi, denn zunehmend würden auch Väter ihr Pensum reduzieren. «Der Zweck der Erziehungsgutschrift besteht darin, den entstandenen Lohnausfall auszugleichen. Das wird mit dem Splitting aber genau wieder rückgängig gemacht.» Das Gericht des Kantons Neuenburg hat diese Argumentation nun gestützt.
Die Differenz bei der Rente erreicht rasch einmal mehrere tausend Franken. Die Erziehungsgutschrift beträgt das Dreifache der jährlichen Minimalrente, was gegenwärtig einem Betrag von 44 100 Franken entspricht. Dieses fiktive Einkommen wird so lange gutgeschrieben, bis das jüngste Kind das 16. Altersjahr erreicht hat.
Ein Fall für die Politik
Das bedeutet am Beispiel einer verheirateten Frau mit zwei Kindern, die über das gesamte Erwerbsleben ein jährliches Einkommen von 30 000 Franken erzielt hat: Wird sie vor dem Mann pensioniert, so beträgt ihre monatliche AHV-Rente gemäss der heutigen Praxis 1798 Franken im Monat. Die Kalkulation basiert auf dem offiziellen Rechner der Ausgleichskassen.
Nimmt man dagegen das Urteil von Neuenburg zum Massstab, also ohne gesplittete Erziehungsgutschrift, dann steigt ihre Rente auf 1960 Franken. Das ergibt eine stattliche Differenz von 162 Franken pro Monat oder – mit der 13. AHV-Rente – von 2106 Franken pro Jahr. Sobald ihr Mann ebenfalls AHV-berechtigt ist, werden ohnehin sämtliche Einkommen seit der Eheschliessung zusammengezählt und durch zwei dividiert. Dann fällt die Verbesserung folglich weg.
Noch ist das Urteil von Neuenburg nicht rechtskräftig. Laut Gnaegi hat die Ausgleichskasse den Fall ans Bundesgericht weitergezogen. Der Direktor von Pro Familia erwartet allerdings ebenso, dass die Politik den Ball aufnimmt. «Die damalige AHV-Revision wollte verhindern, dass die Mutterschaft zu einem Nachteil bei der Rente führt. Doch das Splitting der Erziehungsgutschrift widerspricht genau diesem Ziel.»
Die Genfer SVP-Nationalrätin Céline Amaudruz erklärt auf Anfrage, sie begrüsse das Urteil und sehe ebenfalls politischen Handlungsbedarf. «Offensichtlich besteht hier eine gesetzliche Lücke. Diesen Fehler müssen wir bei der nächsten AHV-Revision behandeln.» Gnaegi ergänzt, das sei für ihn auch keine Frage von rechts oder links. Es gehe ihm lediglich um die Gleichstellung. Jede zweite Frau mit Kindern unter zwölf Jahren reduziere laut der Statistik des Bundes ihr Arbeitspensum auf 50 Prozent oder weniger. Dies sei nach wie vor die Realität, welche auch die AHV berücksichtigen müsse.
Weiterlesen - ein Beitrag von Albert Steck erschienen am 10.09.2024 in der NZZ