Sommersession 2025: Empfehlungen von Pro Familia Schweiz
Am 2. Juni startet die Sommersession in Bern. Hier lesen Sie die Empfehlungen von Pro Familia Schweiz zu den familienpolitischen Vorstössen.
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
Am 2. Juni startet die Sommersession in Bern. Hier lesen Sie die Empfehlungen von Pro Familia Schweiz zu den familienpolitischen Vorstössen.
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
Kinderschutzfälle an Schweizer Kinderkliniken: Zunahme körperlicher Misshandlungen – besonders kleine Kinder weiterhin stark gefährdet.
Die Datenerhebung zu Kinderschutzfällen an Schweizer Kinderkliniken erfolgt weiterhin auf Basis einheitlicher Einschlusskriterien (Alter 0–17 Jahre, direkte ambulante oder stationäre Betreuung, vermutete oder erwiesene Misshandlung, einheitliche Definitionen der Misshandlungsformen) und ermöglicht damit eine verlässliche Vergleichbarkeit über die Jahre hinweg. Auch 2024 basieren die Ergebnisse auf den Rückmeldungen aus 19 Kinderkliniken. Im Jahr 2024 wurden insgesamt 2084 Kinder und Jugendliche in einer der teilnehmenden Schweizer Kinderkliniken wegen vermuteter oder bestätigter Misshandlung betreut oder behandelt. Diese Zahl ist praktisch gleich wie der bisherige Höchststand im Jahre 2023 (2097 Fälle), bleibt aber weiterhin deutlich über dem Wert von 2022 (1889 Fälle). Somit zeigt sich weiterhin eine anhaltend hohe Fallbelastung im Bereich Kinderschutz in der Schweiz.
Weiterlesen - ein Beitrag von Dr. med. Dörthe Harms Huser erschienen auf Pädiatrie Schweiz
Der Bundesrat unterstützt eine flexiblere gesetzliche Regelung der Arbeitszeiten im Homeoffice grundsätzlich.Er will die Vorgaben allerdings auf jene Personen beschränken, die ihre Arbeitszeit zu einem namhaften Teil selbst festlegen können.
Ausgearbeitet hat die Vorlage, zu der der Bundesrat Stellung nahm, die Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Nationalrates. Geplant ist eine Verlängerung der maximalen Zeitspanne für die tägliche Arbeitszeit von 14 auf 17 Stunden. Die Mindestruhezeit soll von elf auf neun Stunden verkürzt werden. Sonntagsarbeit soll an höchstens sechs Sonntagen für jeweils bis zu fünf Stunden bewilligungsfrei möglich sein. Vorgesehen ist auch das Recht auf Nichterreichbarkeit. Die Vorlage schaffe Klarheit, ohne den Gesundheitsschutz zu vernachlässigen, schrieb der Bundesrat. Allerdings will er den Geltungsbereich der neuen Bestimmungen eingrenzen: Während die Kommission die Bestimmungen für alle über 18-jährigen Arbeitnehmerinnen und -nehmer anwenden will, will der Bundesrat sie nur für Personen gelten lassen, die im Wesentlichen selbst entscheiden können, wann sie ihre Arbeit erledigen. Denn nur sie könnten vom Anliegen der Vorlage profitieren, die Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Freizeit möglichst gut zu gestalten. Das Recht auf Nichterreichbarkeit will der Bundesrat allen gewähren, nicht nur jenen Angestellten, die zu Hause oder ausserhalb ihres Betriebs arbeiten.
Sorge vor schlechteren Arbeitsbedingungen
In der Wirtschaftskommission des Nationalrates stellte sich eine Minderheit gegen die vom heutigen Ständerat Thierry Burkart (FDP/AG) noch vor der Covid-19-Pandemie angestossene Vorlage. Sie befürchtet schlechtere Arbeitsbedingungen und weniger Gesundheitsschutz, und dies hätte letztlich hohe Kosten für die Wirtschaft zur Folge.
Weiterlesen - SRF 4 News, 21.5.2025, 15 Uhr ; awp/sda/schc;widb;sten
Obwohl Firmen Erholung propagieren, benachteiligen viele Vorgesetzte jene, die nach Feierabend wirklich abschalten. Eine Studie zeigt, dass Mitarbeiter, die ihre Work-Life-Balance wahren, oft benachteiligt werden. Chefs bewerten solche Mitarbeiter als weniger engagiert, selbst wenn sie produktiver sind. Die Studie kritisiert, dass ständige Erreichbarkeit fälschlicherweise mit Engagement gleichgesetzt wird. Führungskräfte sollten ihre Bewertungskriterien überdenken, um Burnout zu vermeiden.
Eine ausgewogene Work-Life-Balance fördert die Gesundheit und steigert das persönliche Wohlbefinden. Zahlreiche Unternehmen setzen darum zunehmend auf Gesundheitsprogramme, um die Produktivität ihrer Angestellten zu fördern, Fluktuation zu senken und die Zufriedenheit zu steigern. Eine neue Studie, die in der Fachzeitschrift «Organizational Behavior and Human Decision Processes» veröffentlicht wurde, zeigt jedoch einen verborgenen Widerspruch: Obwohl Arbeitgeber ihren Mitarbeitern Erholung nahelegen, benachteiligen sie insgeheim oft jene, die sich tatsächlich abgrenzen.
So wurde die Studie durchgeführt
In 16 Studien mit 7800 Teilnehmern gingen die Forscherinnen Eva Buechel von der Universität Hongkong und Elisa Solinas von der Wirtschaftshochschule IE in Spanien einer einfachen Frage nach: Wie werden Mitarbeiter wahrgenommen, die versuchen, ausserhalb der Arbeitszeit von der Arbeit abzuschalten? Die Forscherinnen präsentierten Managern Profile von Mitarbeitenden, die zwar qualitativ identisch waren (z. B. anhand der jährlichen Beurteilungen der letzten Jahre), sich aber in der Anwendung einer ausgewogenen Work-Life-Balance unterschieden. So etwa hinterliess ein Mitarbeiter während eines Wochenendausflugs eine Abwesenheitsnotiz, der andere hingegen nicht.
Die Reaktion der Befragten
Manager berichteten übereinstimmend, dass Mitarbeiter, die über das Wochenende von der Arbeit abgeschaltet hatten, nach ihrer Rückkehr erholter und produktiver waren und erkannten somit die positiven Auswirkungen einer ausgewogenen Work-Life-Balance auf die Mitarbeiterleistung. Sie bestraften jedoch denselben Mitarbeiter in Beurteilungen und stuften ihn durchweg als weniger engagiert und weniger beförderungswürdig ein als seine Kollegen. Die Chefs hielten an ihrer Entscheidung, selbst wenn der sich abgrenzende Mitarbeiter seine Arbeit objektiv besser erledigte, keiner der beiden Mitarbeiter während seiner Freizeit tatsächlich arbeitete und der Grund für die Abgrenzung tugendhaft war (z. B. die Pflege eines kranken Familienmitglieds).
Resultate der Studie
Die Reaktion war bei Managern, die angaben, Wert auf eine ausgewogene Work-Life-Balance zu legen, genauso stark ausgeprägt wie bei denen, die dies nicht taten.Selbst Manager, die antworteten, in ihren Organisationen ausdrücklich Abgrenzung gefördert zu haben, bestraften in der Studie abgrenzende Mitarbeiter. Die Forscherinnen ziehen daraus ihre erste Schlussfolgerung: «Das ist nicht nur unfair, sondern auch ein Garant für eine Burnout-Kultur.» Das Problem liegt in der Wahrnehmung der Führungskräfte zum Einsatz und Engagement ihrer Angestellten. Menschen würden Sichtbarkeit und Reaktionsbereitschaft als Indikator für Engagement bewerten, heisst es in der Studie. Mitarbeiter, die spätabends Mails beantworten oder auf Ferien verzichten, gelten als besonders engagiert. Diese Denkweise ignoriere jahrelange, unterstützende Forschung, die zeigt, dass Menschen, die sich von der Arbeit lösen, energiegeladener, produktiver und weniger anfällig für Burnout sind, berichtet das Portal «Harvard Business Review».
Mögliche Lösungen
Führungskräfte sollten sich fragen, wen sie belohnen. Sind die bestbewerteten Mitarbeiter diejenigen, die am «verfügbarsten» wirken, oder diejenigen, die tatsächlich die beste Arbeit leisten? Für ein neues Bewertungssystem sollte ständige Erreichbarkeit nicht mit Engagement gleichgesetzt werden. Chefs sollten ihre Mitarbeiter ausserhalb der Arbeitszeiten nicht kontaktieren. Zusätzlich müssen Unternehmen Richtlinien implementieren, die eine gesunde Work-Life-Balance fördern. Unter anderem sollten Führungskräfte darauf geschult werden, Vorurteile zu erkennen, um nicht diejenigen zu bestrafen, die abschalten.
Weiterlesen - ein Beitrag von Karin Leuthold erschienen am 18.05.2025 auf 20min.ch
Die EL-Ausgaben stiegen im Jahr 2023 um 4,0 % auf 5,7 Milliarden Franken. Der Anteil des Bundes an diesen Kosten betrug rund 33 %, den Rest tragen die Kantone. 223 600 Personen erhielten im Dezember 2023 Ergänzungsleistungen (EL) zur Altersversicherung. Das sind 4 500 Personen oder 2,1 % mehr als Ende 2022. Der Anteil der Personen mit einer Altersrente, die auf EL angewiesen sind, bleibt mit 12,3 % stabil. 122 900 Personen bezogen Ende 2023 eine EL zur Invalidenversicherung. Das sind 1 300 Personen oder 1,1 % mehr als im Vorjahr. Der Anteil der IV-Rentner/innen mit EL sank um 0,1 Prozentpunkte auf rund 50,1 %. Eine wichtige Aufgabe übernehmen die EL bei der Finanzierung eines Heimaufenthalts. Ende 2023 wohnten 65 500 Personen mit EL in einem Heim. Sie erhielten im Durchschnitt einen monatlichen Betrag von rund 3 700 Franken. Das ist fast dreimal mehr als der EL-Betrag für eine Person zu Hause.
IV-Statistik 2024
Die Kosten im Gesundheitswesen sind im ersten Quartal um 4,9 Prozent gestiegen. Die Unterschiede zwischen den Kantonen sind gross – und damit auch die für 2026 zu erwartenden Prämienanstiege. Besonders hohe Kostensteigerungen verzeichnen die Kantone Zug (+ 7,5 Prozent) und Luzern (+ sieben Prozent). Der Bundesrat sucht mit einem offenen Briefkasten nach Vorschlägen zur Kostensenkung. Die Krankenkassenprämien könnten 2026 weiter steigen, was viele Haushalte belastet.
Die Krankenkassenprämien werden für viele Menschen in der Schweiz zunehmend zum Problem. Daran dürfte sich auch 2026 kaum etwas ändern – im Gegenteil. Neue Zahlen des Bundesamts für Gesundheit (BAG) zur Entwicklung der Gesundheitskosten im ersten Quartal 2025 zeigen, dass die Kosten erneut gestiegen sind. Diese korrelieren stark mit den Prämien-Anpassungen im Folgejahr.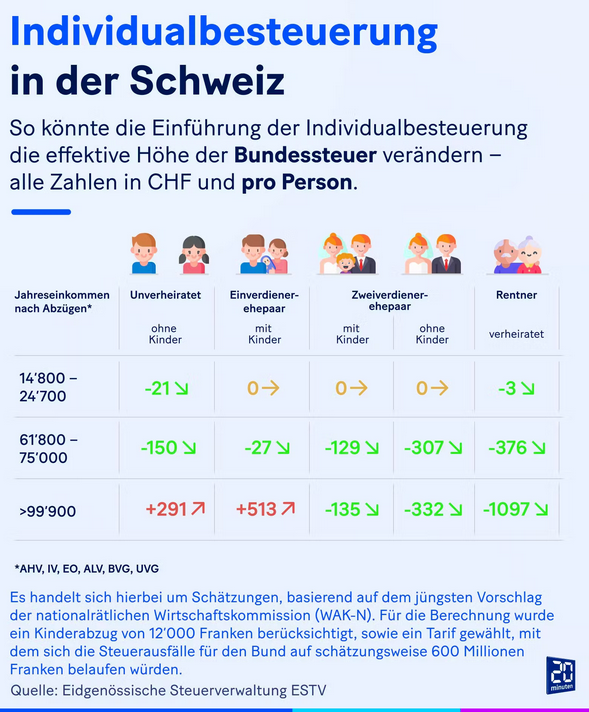
Schweizweit sind die Kosten gemäss BAG-Daten im Vergleich zum Vorjahr um 4,9 Prozent angestiegen. Im Durchschnitt gab eine Person im Jahresverlauf 4754 Franken für von der obligatorischen Krankenkasse gedeckte Kosten aus, 223 Franken mehr als im Vorjahr.
Geringer Anstieg in Schaffhausen – Bern und Zürich im Mittelfeld
Die Unterschiede zwischen den einzelnen Kantonen sind aber beträchtlich, wie die interaktive Grafik zeigt. An der Spitze liegen die Innerschweizer Kantone Zug mit 7,5 Prozent Aufschlag und Luzern mit einem Plus von sieben Prozent. Auch die grossen Kantone St. Gallen (+ 6,4 Prozent), Aargau (+ 5,6 Prozent) und Tessin (+ 5,8 Prozent) verzeichnen deutlich höhere Zahlen. Leicht unter dem nationalen Schnitt liegen Bern (+ 4,1 Prozent) und Zürich (+ 4,7 Prozent). Bloss geringe Kostensteigerungen gab es etwa in Glarus (+ 3,7 Prozent) oder Schaffhausen (+ 1,9 Prozent). Pro Kopf zahlen die Krankenversicherungen in der Romandie und im Tessin die höchsten Beträge aus.
Kosten für Spitex und Arztbehandlungen stark angestiegen
Während ein Tessiner im Schnitt 5915 Franken «kostet», liegt der Betrag für eine Person in Appenzell-Innerrhoden im Durchschnitt nur bei 3439 Franken. Entsprechend sind auch die Krankenkassenprämien deutlich tiefer. Deutlich höhere Ausgaben verursachten gemäss den neuesten Zahlen vor allem Spitex-Organisationen (+ 11,2 Prozent), Laboratorien und Arztbehandlungen. Was die entsprechenden Branchen zum Kostenanstieg sagen, kannst du in diesem Artikel nachlesen.
Gesundheitskosten: Bundesrat bittet Bevölkerung um Mithilfe
Die steigenden Gesundheitskosten beschäftigen auch den Bundesrat. Um diese zu bekämpfen, holt der Bund nun sogar die Bevölkerung ins Boot. Am Donnerstag öffnete das BAG einen elektronischen Briefkasten für Vorschläge, die geeignet sind, das Kostenwachstum in der obligatorischen Krankenkasse zu senken. Bis 20. Juni können Bürgerinnen und Bürger anonym ihre Ideen einreichen. Im November rief Gesundheitsministerin Elisabeth Baume-Schneider (SP) den Runden Tisch «Kostendämpfung» ins Leben. Eine Expertengruppe wird die eingereichten Vorschläge prüfen und im Gremium diskutieren. Im September wird Baume-Schneider dann verkünden, wie sich die Prämien in den einzelnen Kantonen für 2026 entwickeln.
Weiterlesen - ein Beitrag von Christof Vuille erschienen am 19.05. auf 20min.ch