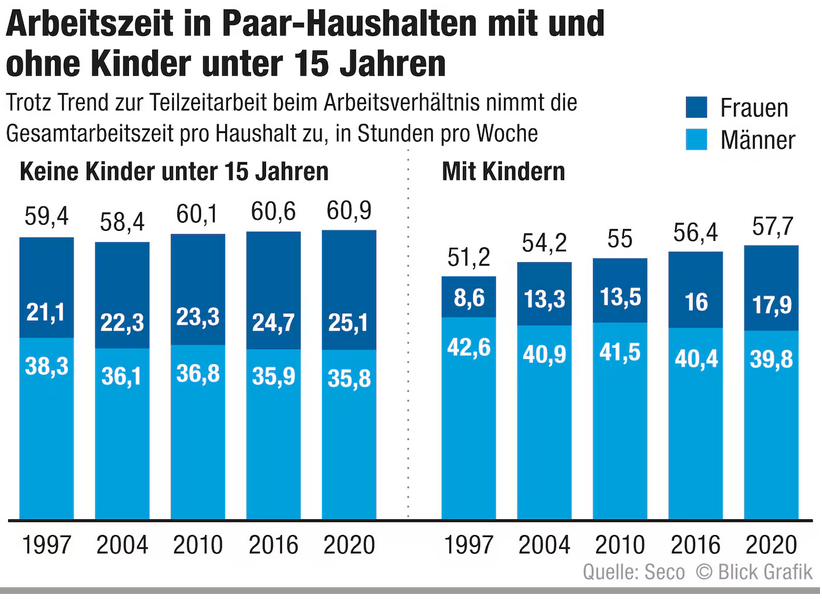In der Studie, die bereits 2019 veröffentlicht wurde, untersuchten die Wissenschaftler:innen die Einkommen in verschiedenen Ländern – in Deutschland wurde sich der Daten des Sozio-oekonimischen Panel (SOEP) bedient. Dabei handelt es sich um "die größte und am längsten laufende multidisziplinäre Langzeitstudie in Deutschland", heißt es vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung Berlin. Laut den Ergebnissen verdienen Frauen im Durchschnitt im ersten Jahr nach der Geburt ihres Kindes 80 Prozent weniger als Männer. Und auch nach zehn Jahren sind es immer noch im Schnitt 61 Prozent. Bei Männern gibt es den Effekt der "Kinderbestrafung" nicht. Die Einkommenseinbüßen lassen sich durch einige Faktoren erklären: Wenn die Mutter nach der Geburt zum Beispiel gar nicht mehr oder nur noch in Teilzeit arbeiten geht. Langfristig büßen in den untersuchten Ländern Frauen in Deutschland am meisten von ihrem Gehalt ein, wenn sie ein Kind bekommen. Am wenigsten finanzielle Verluste machen Frauen in Dänemark: Hier liegen die Einkommensverluste laut der Studie bei 21 Prozent. Auch Frauen in Schweden, das eigentlich für eine Politik der Vereinbarkeit bekannt ist, verdienen im Durchschnitt 27 Prozent weniger.
Das Phänomen ist nicht neu
Die Studienergebnisse sind an und für sich keine Neuheit: Bereits im Jahr 2001 wurde eine Studie mit dem Titel "The Wage Penalty for Motherhood" (zu Deutsch: "Die Gehaltsstrafe für Mutterschaft") veröffentlicht, die ebenfalls zu dem Ergebnis kam, dass es die Frau ist, die finanziell für die Elternschaft Einschränkungen hinzunehmen hat. Eine andere Studie zeigt hingegen, dass Frauen unter bestimmten Voraussetzungen keine Einbrüche in ihrer Lohnentwicklung zu befürchten haben: Die nämlich, "die ihre Erwerbsarbeit höchstens für die Dauer der gesetzlich vorgesehenen Elternzeit unterbrechen", heißt es in der Studie. Wer darüber hinaus keiner Lohnarbeit nachgeht, müsse mit "beträchtlichen Lohneinbußen" rechnen. Verwendete Quellen: sueddeutsche.de, capital.de, diw.de
Weiterlesen - ein Beitrag erschienen am 07.03.2024 auf www.eltern.de