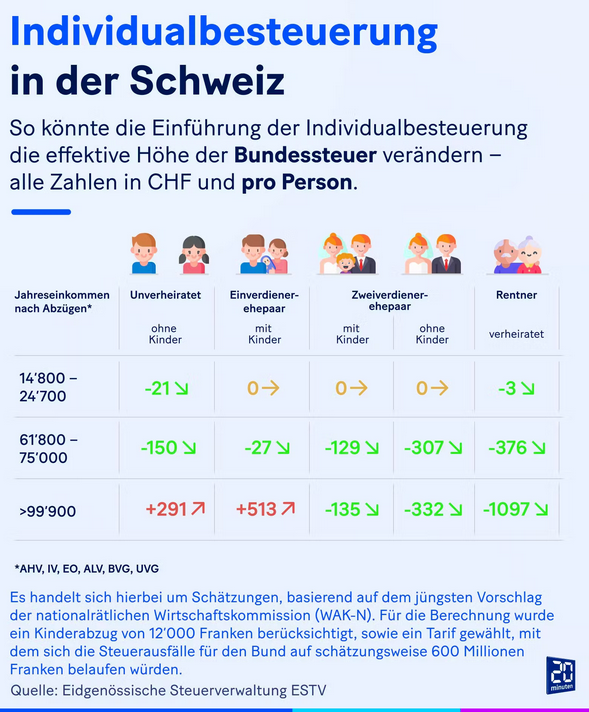Die Gesundheitskosten stiegen 2023 um 2,4%
2023 kostete das Schweizer Gesundheitswesen 94 Milliarden Franken, 2,4% mehr als im Vorjahr. Das Gesundheitswesen wurde zu über 60% von den Haushalten finanziert, entweder direkt oder über die Krankenversicherungsprämien. Gemäss den Schätzungen des Bundesamtes für Statistik (BFS) dürften die Kosten 2024 um mehr als 3% ansteigen.
Die Kosten für Pflegeleistungen, die unter anderem in den Spitälern, Arztpraxen und sozialmedizinischen Institutionen erbracht werden, nahmen zwischen 2022 und 2023 um 6,0% zu. Der Anstieg der Kosten für Gesundheitsgüter wie Medikamente oder therapeutische Apparate war mit +3,4% etwas moderater. 2023 machten die Pflegeleistungen und die Gesundheitsgüter zusammen über drei Viertel der Kosten für Gesundheitsleistungen aus.
Starker Rückgang der Präventionsausgaben
Für Prävention wurde 2023 insgesamt 53,5% weniger ausgegeben als im Vorjahr, das noch von der Covid-19-Pandemie geprägt war. Auf sie entfielen weniger als 2% der gesamten Gesundheitskosten 2023. Auch die Kosten für Laboranalysen waren rückläufig (-8,9%). Demgegenüber stiegen die Radiologiekosten weiter an (+7,0%). Die Zunahme der Verwaltungskosten, die hauptsächlich den administrativen Aufwand der Krankenversicherer abdecken, fiel 2023 mit 9,6% besonders markant aus.
Kostenanstieg bei den Arztpraxen um 7%
Die Spitäler waren mit 36,3% der Gesamtkosten 2023 die wichtigsten Leistungserbringer. Die Spitalkosten erhöhten sich zwischen 2022 und 2023 um 4,5%. Bei den Arztpraxen aller Fachrichtungen belief sich das Kostenwachstum auf 7,1% und bei den sozialmedizinischen Institutionen auf 4,6%. Besonders stark fiel der Anstieg 2023 bei den Spitex-Diensten aus (+7,9%), wobei diese Kosten weniger als 4% der gesamten Gesundheitskosten ausmachten.
Grosse kantonale Unterschiede
2023 waren die höchsten Gesundheitskosten im Kanton Basel-Stadt zu verzeichnen (13 600 Franken pro Kopf). Am anderen Ende der Rangliste fielen die Kosten im Kanton Zug nahezu 40% tiefer aus (8600 Franken pro Kopf). Der Kostenanteil für ambulante Leistungen lag zwischen 53,4% im Kanton Genf und 34,8% im Kanton Uri.
Die Haushalte tragen den Grossteil der Gesundheitskosten
Die Privathaushalte sind der wichtigste Finanzierungsträger des Gesundheitswesens. Sie bezahlten 21,8% der Gesundheitskosten aus der eigenen Tasche und 39,5% in Form von indirekten Beiträgen, hauptsächlich über die Krankenversicherungsprämien. Der Restbetrag wurde weitgehend von der öffentlichen Hand, namentlich von den Kantonen, übernommen. Die Gesundheitsausgaben der Haushalte stiegen zwischen 2022 und 2023 um 4,7% an, jene der Kantone um 1,9%.
Weiterlesen